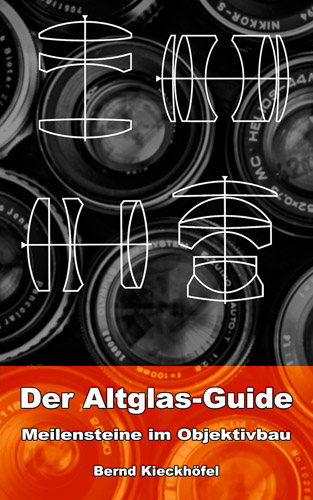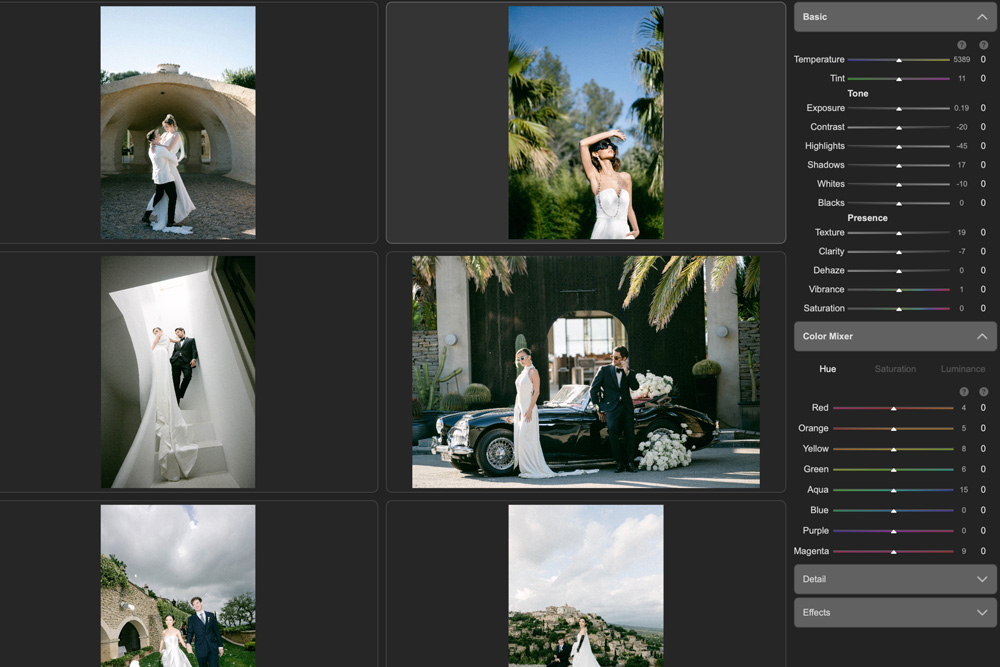Offiziell war das private Fotografieren an der Front verboten, ließ sich jedoch leicht umgehen. Ab 1917 zensierte das von der Obersten Heeresleitun gegründete Bild- und Filmamt (BUFA) rigoros alle Veröffentlichungen. Der Krieg wurde zum ersten umfassenden Propagandakrieg und prägte die weitere Bildberichterstattung nachhaltig.

Die BUFA-Zensur war umfassend. Bilder mussten eine geschönte Realität zeigen; nur tote Soldaten des Feindes durften abgebildet werden. Auch England, Frankreich, Österreich und die USA führten eine vergleichbare Zensur ein. Da Fotografieren während der Kämpfe technisch kaum möglich war, stellten akkreditierte Fotografen Szenen nach und profitierten von der militärischen Logistik, etwa bei der Anfertigung von Feldpostkarten. 2010 wurden über 100 verschollen geglaubte Fotos von Werner Kleinfeldt entdeckt, der mit knapp 16 Jahren freiwillig in den Krieg gezogen war. Doch auch für private Aufnahmen galt ein unausgesprochenes Tabu: Verluste auf eigener Seite dokumentieren sie nur indirekt durch Fotos von Grabkreuzen gefallener Kameraden.


Während des Ersten Weltkriegs akzeptierten Zeitungen die geringere Auflösung kleinerer Formate. Der Pressefotograf Ludwig Boedecker schwärmte von seiner Goerz Pocket Tenax für das 9×12-Format: „Hunderte Veröffentlichungen und eine Anzahl von Titelbildern der Berliner Illustrierten Zeitung …“ sollen damit entstanden sein. Diese Entwicklung sowie verbesserte Drucktechniken ebneten den Weg für kleinere Formate, wovon später die Leica und der Kleinbildfilm profitierten.

Nach 1918 kehrte die professionelle Fotografie den kleinen Kameras wieder den Rücken und wandte sich dem Format 13×18 zu. Kontaktabzüge ließen sich schneller und einfacher herstellen als Vergrößerungen, was den Versand an Redaktionen vereinfachte. Für den privaten Gebrauch blieben Rollfilmkameras weiterhin beliebt. Das Verbrauchsmaterial war günstig, und die kleinen Kontaktabzüge waren für Erinnerungsfotos ausreichend.