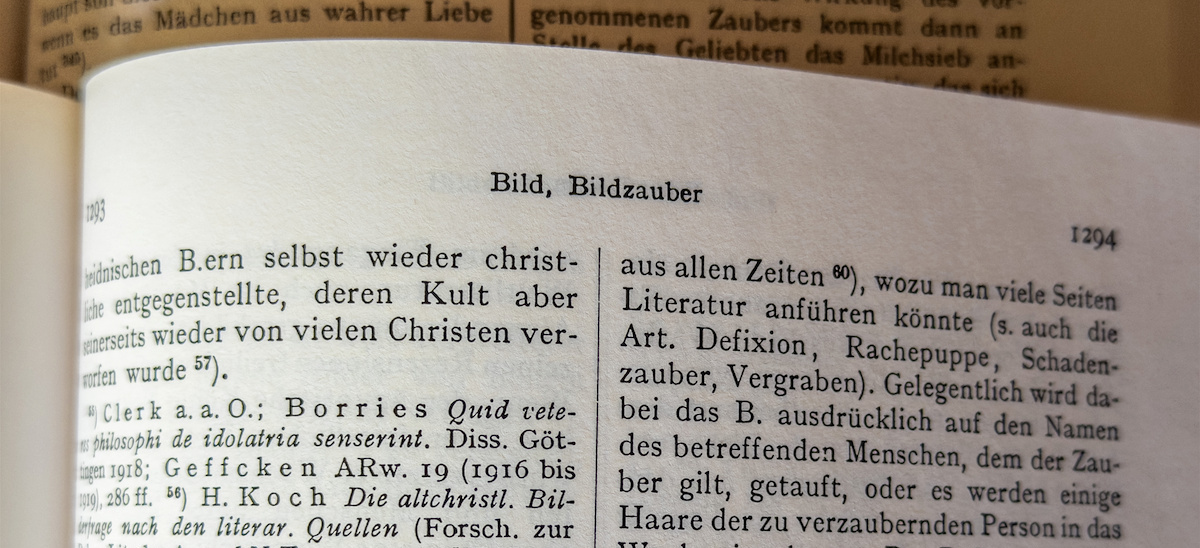Mauern, Messer und Olivenbäume

Vor einer Woche hatte Doc Baumann hier über seine Israel-Reise berichtet und vom Holocaust-Museum Yad Vashem. Eine Stunde nach dem Besuch dort fuhr er an der hohen, von Israel durch das Land gezogenen Grenzmauer entlang, um den restlichen Tag auf palästinensischem Gebiet zu verbringen. Beim Passieren der Kontrollposten erinnerte er sich an die Warnungen seiner Bekannten vor der Fahrt: „Bist Du verrückt? Das ist doch lebensgefährlich, gerade jetzt nach Israel zu fahren!“
Seit 1991 recherchiere ich für den Roman, mit dessen Niederschrift ich nun endlich beginnen will. In diesen Jahren habe ich alle Schauplätze, die in der Handlung vorkommen, teils mehrfach besucht: Rom, London, Cornwell, Paris, die Champage, Südfrankreich, New York, Rhodos … nur nach Jerusalem hatte ich mich nie gewagt. Jedes Mal, wenn ich den Entschluss zu einer Fahrt dorthin gefasst hatte, gab es neue Unruhen, und ich sagte das Vorhaben aus Sicherheitsbedenken wieder ab.
Gewiss hätte ich auch 2015 wieder einen Rückzieher gemacht, wenn ich mich kurzfristig für die Fahrt entschieden hätte. Doch ich hatte sie bereits im Frühling gebucht, als noch alles ruhig war, und das Geld überwiesen. (Dass ich Atheist bin, hat mich nicht daran gehindert, mit einer katholischen Pilgergruppe zu fahren.) Je näher der Reisetermin rückte, um so häufiger berichteten die Medien von Messerangriffen junger Palästinenser. Seit Anfang Oktober 2015 wurden fast 80 von ihnen von israelischen Soldaten erschossen, zehn Israelis kamen bei solchen Angriffen ums Leben.
Fahren oder nicht? Eine Stornierung wäre jetzt teuer gewesen. Aber lieber auf das Geld verzichten, als erstochen werden. Den Ausschlag gab ein Telefongespräch mit einem Freund, der Informatiker ist und mir klar machte, wie gering trotz allem das statistische Risiko ist. Nicht viel höher als das der Busfahrt zum Flughafen in Frankfurt. Also fahren, wenn auch mit einem etwas unguten Gefühl. Wenn nicht diesmal, dann wahrscheinlich nie.
Nun saß ich also in unserem Reisebus auf der Fahrt in palästinensisches Gebiet. Vor einer Stunde hatte ich noch die Dokumentation des Grauens im Holocaust-Museum Yad Vashem erlebt (darüber berichtete ich im DOCMA-Blog vor einer Woche), was die Generation unserer Väter und Großväter den Juden angetan hat. Für mich hatte ich daraus gelernt: Zum einen darf so etwas nie wieder passieren – und verständlicherweise würde jeder Jude ergänzen: So etwas darf uns nie wieder passieren. Zum anderen: Die Würde des Menschen ist (soll sein) unantastbar. Man darf sie anderen nicht nehmen (nicht nur deshalb, weil man damit die eigene verliert).
Entlang der Straße tauchte eine gewaltige Betonmauer auf, die das Land zerschneidet; die abgerissene in Berlin wirkt dagegen wie eine Stolperschwelle. Die Einreise ins Westjordanland ist problemlos, für einen Bus mit gelbem Nummernschild und europäischen Touristen ohnehin. In der Gegenrichtung, nach Israel hinein, ist es weit schwieriger – für Palästinenser praktisch unmöglich.
Was hatte ich in Jerusalem mitbekommen vom befürchteten Konflikt? Fast nichts. Nur einmal, auf dem Tempelberg, den Felsendom vor mir und die El Aqsa-Moschee im Rücken, gab es plötzlich einen Aufruhr. Nationalreligiöse Juden hatten versucht, auf den Berg zu kommen, um zu beten. Nicht aus religiösen Gründen, das Betreten des Haram ist frommen Juden streng verboten, weil sie versehentlich auf die Stelle des Allerheiligsten des Herodianischen Tempels treten könnten, ein schweres Sakrileg! Das Gebet dient allein dazu, die Muslime, unter deren Verwaltung der Tempelberg steht, zu provozieren. So ließ die – israelische – Polizei sie denn auch nicht weiter. Umgehend gab es empörte Sprechchöre der Muslime: „Allahu akbar! – Gott ist groß!“ Er würde wahrscheinlich auch nicht kleiner, wenn die Juden hier beten, aber als Atheist mischt man sich besser nicht in religiöse Konflikte ein. Und man lernt spätestens hier, dass die nur stellvertretend stehen für politische.

Ach ja, was ich davon noch mitbekommen hatte: Es blieb wahrscheinlich auch deswegen so ruhig, weil an jeder Ecke kleine Gruppen schwerbewaffneter israelischer Soldat/innen mit Gewehr im Anschlag stand, vor allem im moslemischen Teil Jerusalems. Dort schützen sie unter anderem Häuser, die Juden mitten im arabischen Teil der Stadt über Stromänner gekauft haben und aus denen nun mit provozierendem Besitzanspruch isrealische Fahnen hängen.
Und nun fuhren wir also über die Grenze ins Palästinensergebiet, diesmal auf der anderen Seite der Mauer entlang. Auf dem Weg nach Bethlehem, schließlich war ich ja mit christlichen Pilgern unterwegs. Irgendwann musste der Bus wenden, israelisches Militär hatte die Straße gesperrt, am nächsten Tag wollten fromme Juden hier am Grab Rachels beten.

Unsere Gruppe war natürlich wegen der Geburtskirche Jesu hier, aber auch, um Kleidung und Spielzeug in ein aus Deutschland unterstütztes Kinderkrankenhaus zu bringen (auch ich hatte dafür auf dem Flohmarkt ein Bündel kleiner Hosen und T-Shirts erworben und in den Koffer gepackt). Doch beim Gespräch hörten wir nicht nur etwas von den medizinischen Aufgaben, sondern auch von den Kindern, die nicht behandelt werden können, weil ihre Eltern die Fahrt hierher nicht mehr wagen. Von der israelischen Siedlung vor den Toren Bethlehems, die wie eine Festung auf einem Hügel thront, illegal errichtet wie alle anderen auch, auf dem Grund palästinensischer Besitzer, die, wenn sie sich mit ihren Besitzurkunden den Baggern protestierend in den Weg stellen, von den neuen „Besitzern“ kühl belehrt werden, deren Besitzansprüche seien bedeutend älter. Die Bibel in der Hand soll es belegen, das israelische Militär setzt diese Sichtweise auch bei mangelnder Einsicht durch. Da wird dann schon mal jemand erschossen, der allzu vehement darauf besteht, das sei sein Land, und die dort stehende Olivenbaumplantage seine Lebensgrundlage, seit Generationen im Familienbesitz. Das kümmert die Besatzer nicht, weder in diesem Fall noch in den vielen anderen, in denen palästinensische Bauern nicht mehr zu ihren Olivenbäumen jenseits der Mauer fahren dürfen.
Am Abend ist die Reisegruppe bei einer Autorin zu Gast. Auch sie berichtet Bedrückendes: Wie ihr alter Vater auf dem Weg zur Arbeit grundlos von Soldaten erschossen wurde, wie die israelische Regierung nicht nur illegale Siedlungen zulässt und verteidigen lässt, sondern auch selbst errichtet, Bewohner mit Subventionen und Steuererleichterungen in die Gebäude zieht (und wenn es nur ein paar wenige sind, ein neuer Pflock ist ins Land der Palästinenser gerammt), wie der Aufbau einer eigenen Industrie verhindert wird und die Menschen deshalb Produkte aus Israel – selbst aus den illegalen Siedlungen – kaufen müssen, denn andere gibt es nicht, und über die – besonders bei jungen Männern – extrem hohe Arbeitslosigkeit. „Sie haben nichts mehr zu verlieren“, sagt unsere Gastgeberin.

Wie ein Krebsgeschwür zerfressen die Siedlungen die palästinensische Landkarte. Die Bevölkerung will nur noch Frieden und das Ende der Besatzung. Das erschien 1993 nach dem Abkommen von Oslo in Sichtweite, doch die zunehmend nach rechts rückenden Regierungen von Israel haben den Siedlungsbau nicht gestoppt, im Gegenteil. Die Situation ist hoffnungsloser denn je, eine Lösung nicht in Sicht.
Für meinen Roman, für die Beschreibung Jerusalems und der judäischen Wüste, habe ich viel gelernt auf dieser Reise. Sogar von einer neuen Verschwörungstheorie habe ich erfahren, von sachkundiger Seite und recht plausibel: Dass fundamentalistische Juden und palästinensische Terroristen gemeinsam Attentate planen, um den Staat Israel zu schwächen, wenn möglich auszulöschen. Den einen ist er im Weg, weil er die Wiederkehr des Messias verhindert (dabei werden sie von evangelikalen Gruppen aus den USA kräftig unterstützt, die seit langem Konten für die Errichtung des Dritten Tempels füllen) – die anderen wollen ihr Land wieder haben. (Es wäre einen weiteren Roman wert, sich auszumalen, wie diese drei Religionen sich zerfleischten, sollte die Vernichtung Israels gelingen.)
Aber auch anderes wird mir nun klarer. Unsere Medien versorgen mich zwar ständig mit neuen Meldungen über die Messerattacken junger Palästinenser – berichten aber nie, wenn wieder und wieder von Israelis illegale Siedlungen errichtet werden, wenn Menschen vertrieben, enteignet, um ihren Lebensunterhalt und ihre Hoffnungen auf die Zukunft gebracht werden. Die Mehrheit der Palästinenser verurteilt diese Attentatsversuche, auch dann, wenn sie die Ursachen der dahinterstehenden Verzweiflung und Aussichtslosigkeit kennt. Die Häuser, in denen die Großfamilien erschossener Attentäter leben, werden nach Sippenhaft-Logik eingerissen, ob die Angehörigen von der Tat wussten oder nicht. Das erscheint, von Europa aus betrachtet, als wirksame Vorbeugungsmaßnahme – erlebt man es hier, wo jeder solche Familien und ihr Elend kennt, lernt man, es anders zu sehen.

Auf dem Rückweg in der Nacht nach Jerusalem, auf israelisches Gebiet, ist die Kontrolle deutlich strenger, bewaffnete Soldaten marschieren durch den Bus. Wie die letzten Wahlen gezeigt haben, ist ein großer Teil der Israelis – wenn auch die Minderheit – gegen die Regierungspolitik und will Frieden. Ende Oktober 2015 demonstrierten Tausende in Tel Aviv und riefen „Juden und Araber wollen sich nicht hassen“. So werden auch viele dieser jungen Soldaten all dies gegen ihre Überzeugung tun müssen.
Was waren meine Gedanken gewesen, als ich vor einem halben Tag das Holocaust-Museum verlassen hatte? Der eine: So etwas darf nie wieder passieren – und ich verstehe jeden Juden, der betont: So etwas darf uns nie wieder passieren. Der andere: Die Würde des Menschen ist (soll sein) unantastbar. Man darf sie anderen nicht nehmen. Doch die Pläne für eine „ethnische Säuberung Palästinas“ (so der Titel eines Buches von Ilan Pappe) entstanden nicht vor ein paar Jahren, sondern bereits Anfang 1948, rund zwei Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Mir scheint, die israelischen Regierungen – nicht „die Juden“ – haben nur den ersten Teil gelernt und den zweiten darüber vergessen.