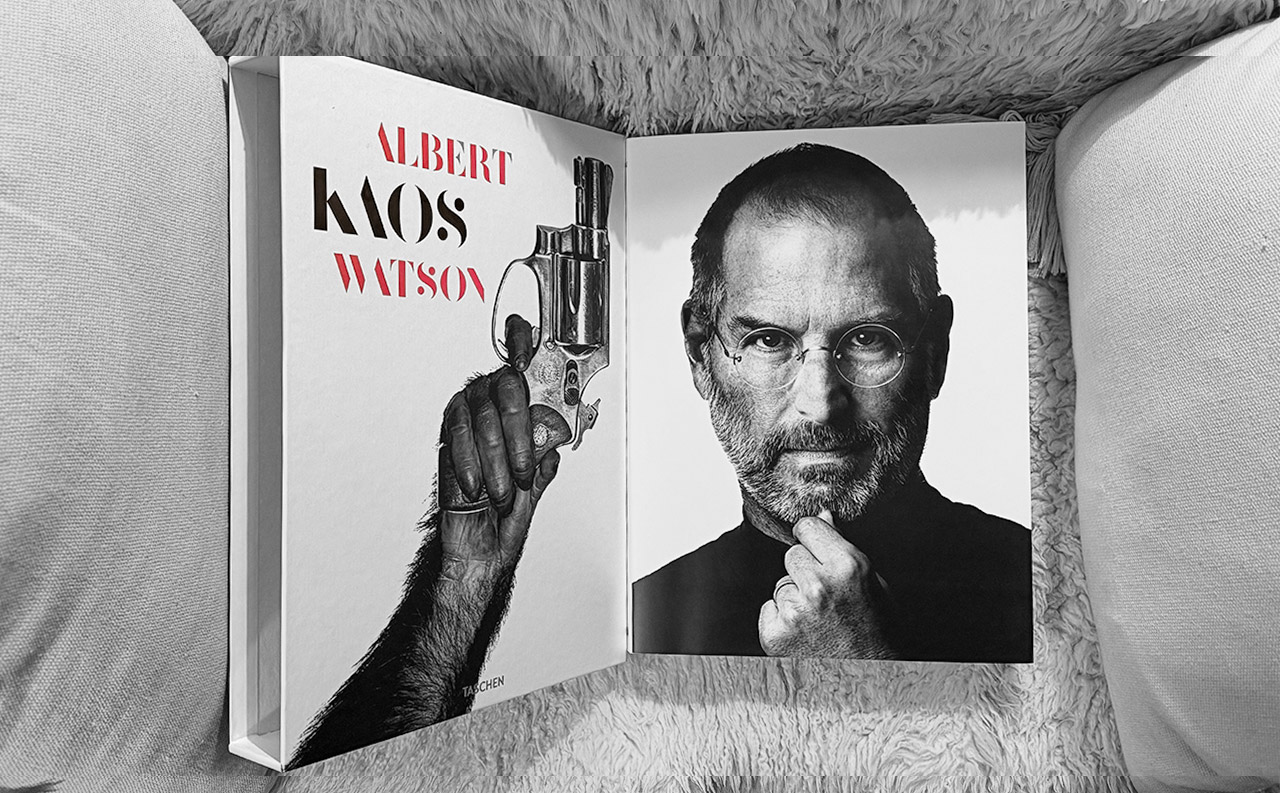Falsche Elfen und gelöschte Zeitgenossen
Auf der einen Seite eine Romanfigur, die auch nach weit über 100 Jahren Literaturgeschichte der Prototyp für kristallklares logisches Denken und die Zurückweisung allen Okkultes ist – auf der anderen Seite der vertraute Umgang mit der Geisterwelt und die felsenfeste Überzeugung, Fotos von Elfen seien authentisch; wie passt das zusammen? Den Schriftsteller Arthur Conan Doyle kennen die meisten von uns nur noch als Verfasser der Sherlock-Holmes-Geschichten. Er selbst hat das immer bedauert und gehofft, dass man sich anderer Werke wegen an ihn erinnern würde. Zum Beispiel solcher über den Spiritismus oder eben seiner Analysen der Elfenfotos von Cottingley (1917).
Doyle, von Beruf zunächst Augenarzt, hat zahlreiche Aufsätze in englischen Fotozeitschriften publiziert, war also mit der Materie vertraut, auch mit den Manipulationsmöglichkeiten. Mit seiner Einschätzung der Echtheit der Elfenfotos war er keineswegs allein; er füllte Säle mit seinen Vorträgen. Auch Fachleute von Kodak konnten nichts finden, was auf eine Fälschung hinwies. In der Tat hätte man vergeblich nach Retuschen oder Mehrfachbelichtungen gesucht – dass die geflügelten Wesen, die sich von drei Teenagern hatten ablichten lassen, aus Papier ausgeschnitten und in die Szene gehängt worden sind, erkennt man heute auf den ersten Blick.

Doyle allerdings zweifelte weder an deren Echtheit noch an der von Geisterfotos, auf denen in Trance gefallenen Medien Ektoplasmaströme (die stark an Watte und Tüll erinnern) aus Mund und anderen Körperöffnungen quellen. Er musste dazu nicht einmal die messerscharfen Deduktionen seines Geschöpfs Sherlock Holmes aufgeben: Geister – und Elfen schon gar nicht – waren für ihn kein Bestandteil einer jenseitigen Welt des Übernatürlichen, sondern gehörten schlicht unserer normalen Welt an – was schon dadurch belegt war, dass sie fotografiert werden konnten. Doch neben seinem Versuch, diese Fotos mit den strengen Mitteln der Wissenschaft als echt zu beweisen, schwingt auch eine Hoffnung mit: „Die Anerkennung ihrer Existenz wird das materialistische Denken des zwanzigsten Jahrhunderts aus seiner tiefen, morastigen Spur rütteln und die Zeitgenossen zu dem Eingeständnis bewegen, dass es doch so etwas wie Zauber und Mysterien im Leben gibt.“ Dagegen Sherlock Holmes: „Uns reicht die Welt schon so, wie sie ist; für Geister haben wir keine Verwendung.“
Die Geschichte dieser erstaunlichen Vereinigung des scheinbar Gegensätzlichen rekonstruiert Bernd Stiegler in seinem lesenswerten Buch „Spuren, Elfen und andere Erscheinungen. Conan Doyle und die Photographie“ – eine angenehme Wochenendlektüre, die uns an ungewöhnlichen Beispielen zeigt, dass Fälschungen seit jeher zum Medium Fotografie gehören.

Dass es in der Geschichte der Fotografie keineswegs bei harmlosen Elfen blieb, beschreibt Hans Becker von Sothen in „Bild-Legenden. Fotos machen Politik. Fälschungen – Fakes – Manipulationen“. Nur die letzten Seiten befassen sich – naturgemäß – mit digitalen Verfälschungen. Der Verfasser beschreibt auch Aspekte, die sonst oft zu kurz kommen: Die Inszenierung des Fotografierten etwa, die durch keine noch so akribische technische Analyse aufgedeckt werden kann, den medialen Kontext oder die Rolle der Bildunterschrift. Den Schwerpunkt des Buches bilden die vielen Einzelkapitel vom Krim-Krieg Mitte des 19. bis zum Syrien-Krieg Anfang des 21. Jahrhunderts. Etliche bekannte Bildfälschungen der letzten Jahre fehlen in dieser Zusammenstellung – man könnte auch argumentieren, sie seien inzwischen bekannt genug und müssten nicht noch einmal analysiert werden.
So heterogen wie das Material und die jeweiligen (politischen) Hintergründe der Foto(ver)fälschungen sind die jeweils angewandten Methoden. Dadurch nehmen die Kapitel mitunter den Charakter des Anekdotischen an; man erfährt zwar viel Wissenswertes, der Autor bewegt sich aber oft zu weit vom Thema fort. Einer unangestrengten Lektüre kommt das sicherlich entgegen – für ein Sachbuch hätte man sich oft eine klarere Strukturierung gewünscht, auch beim mitunter recht gedrängten Layout.
Unter diesen Aspekten ist die zehnseitige Einleitung am fruchtbarsten (und bringt den Lesern ein Vielfaches von dem, was Frank Miener in seinem bemühten und auch stilistisch unzumutbaren Büchlein „Bilder, die lügen. Tourist Guy und Co. – Digitale Gefahr für die Medien“ ausbreitet). Einig sind sich beide Autoren allerdings in der Aussage, die Miener seinem Buch als Titel mitgibt: Bilder könnten lügen; eine unzutreffende Basisannahme, die sich in fast allen Texten zum Thema findet und die damit den grundlegenden Unterschied zwischen sprachlichen Lügen und irreführenden Bildern verwischt. Viele Ausführungen wären überflüssig, würde die Logik der Sprache nicht unzulässig auf die der Bilder übertragen. Daher: mit (kleinen) Einschränkungen, empfehlenswert.
Diese Buchrezension finden Sie auch im neuen DOCMA-Heft, das Sie in unserem Webshop bestellen können.
 Wenn Sie sofort weiterlesen möchten, kaufen Sie sich im Webshop die PDF-Version des Heftes.
Wenn Sie sofort weiterlesen möchten, kaufen Sie sich im Webshop die PDF-Version des Heftes.