Wie gefährlich ist der Duden?
In den letzten Tagen machte eine Petition des Vereins Deutsche Sprache (VDS) die Runde, mit der nichts weniger als die deutsche Sprache vor dem Duden gerettet werden soll. Klingt schräg? Dachte ich auch, aber einige meiner DOCMA-Kollegen haben die Petition unterschrieben. Ich nicht.
In DOCMA geht es um Bildbearbeitung und Fotografie, aber uns geht es immer auch um die deutsche Sprache. Es ist ja eine Sache, zu wissen, wie es geht, aber man muss das auch klar und verständlich ausdrücken können. Wenn wir unsere Artikel gegenseitig korrigieren, spielen Feinheiten des sprachlichen Ausdrucks eine große Rolle, denn die erste Formulierung, die man findet, ist längst nicht immer die beste. Wenn es um die Verteidigung der deutschen Sprache geht, sind wir also ganz vorne dabei. Die beste Verteidigung besteht darin, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen, und als Inspiration empfehle ich den Klassiker von Judith Macheiner: „Das grammatische Varieté oder Die Kunst und das Vergnügen, deutsche Sätze zu bilden“, erschienen als Band 74 in „Die Andere Bibliothek“ im Eichborn Verlag (und aktuell leider vergriffen).
Der Duden – der Rechtschreibduden, das Duden Wörterbuch und all die anderen Bände, die im Dudenverlag erschienen sind – wirken vielleicht nicht ebenso inspirierend, aber sie sind eine wichtige Referenz in Zweifelsfragen, die wir ständig nutzen. Und dieser Instanz wirft der Verein Deutsche Sprache nun eine „problematische Zwangs-Sexualisierung“ vor. Klingt unanständig, aber was ist damit gemeint?
Die deutsche Sprache hat ja die Eigenheit, dass in ihr jedes Nomen einen Genus hat, ein grammatisches Geschlecht, selbst Wörter, die sich auf Unbelebtes oder jedenfalls Geschlechtsloses beziehen. Ausländer, die unsere Sprache zu lernen versuchen, verzweifeln oft daran, weil sie nicht verstehen, warum es „die Suppe“, „das Hauptgericht“ und „der Nachtisch“ heißt. Wenn wir aber von Menschen oder Tieren reden, die ja ein Geschlecht haben, müssen wir uns durch die Wortwahl zu einem Geschlecht bekennen, auch wenn wir eigentlich davon abstrahieren möchten. Für den Engländer hat beispielsweise „the customer“ kein bestimmtes Geschlecht, aber als Deutsche müssen wir uns zwischen „dem Kunden“ oder „der Kundin“ entscheiden. Es gibt aber auch so etwas wie ein „generisches Maskulinum“, wie man es seit rund 40 Jahren nennt: Die maskuline Form „der Kunde“ kann auch im geschlechtsneutralen Sinn von „der Kunde oder die Kundin“ gebraucht werden. In DOCMA können wir von „Photoshop-Anwendern“ sprechen und die Anwenderinnen damit nicht ausschließen. Allerdings ist das generische Maskulinum umstritten, und zwar schon fast so lange, wie es diesen Begriff im Deutschen überhaupt gibt. (Übrigens existiert auch ein generisches Femininum, nur ist es viel seltener und eher im Tierreich anzutreffen: Unter „zehn Katzen“ kann sich auch ein Kater befinden, unter „zehn Katern“ aber keine weibliche Katze.)
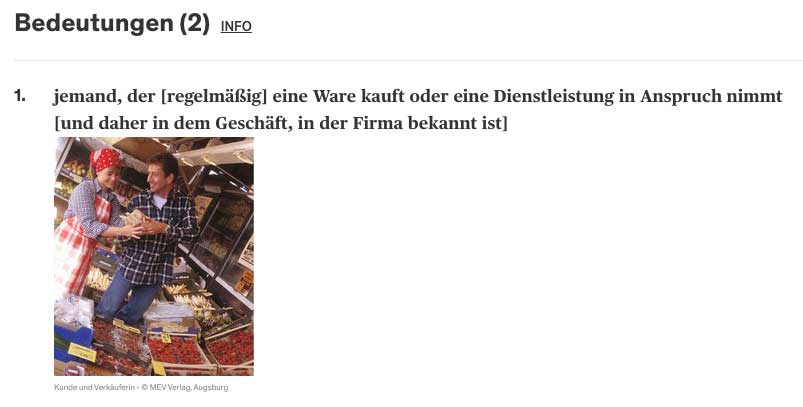
Befragt man kompetente Sprecher des Deutschen, dann akzeptieren sie eine Aussage wie „10 Kunden befanden sich im Laden, drei Männer und sieben Frauen“ als korrekten deutschen Satz. Das generische Maskulinum scheint also zu funktionieren. Bittet man sie aber, sich „einen Kunden“ vorzustellen, dann denken sie, wie Experimente zeigen, fast immer an einen Mann – im Zweifelsfall ist das generische Maskulinum doch ein bisschen mehr Maskulinum als generisch.
Viele Frauen haben sich schon daran gestört, in der deutschen Sprache weniger zu zählen. Neun männliche Kunden und eine Kundin bleiben „Kunden“, aber wenn sich zu neun Kundinnen ein Mann gesellt, werden sie damit ebenfalls zu zehn „Kunden“. Egal wie viele Frauen sich in einer Gruppe befinden – ein einziger Mann genügt, um das grammatische Geschlecht der ganzen Gruppe zu ändern, beliebig viele Frauen jedoch nicht.
Die Duden-Redaktion hatte bisher das generische Maskulinum akzeptiert. Es gibt einen Eintrag für den „Kunden“ und die „Kundin“, und während beim „Kunden“ das Geschlecht offen bleibt („jemand, der [regelmäßig] eine Ware kauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt“), wird als Bedeutung der „Kundin“ nur angeben, dass es die weibliche Form des „Kunden“ sei und für eine genauere Erklärung auf den Eintrag für diesen verwiesen.
Für „Kunde“ und „Kundin“ gilt das bis heute, aber die Einträge vieler anderer Wörter hat die Redaktion in der Online-Version des Duden überarbeitet. Der „Mieter“ beispielsweise ist nun kein generisches Maskulinum mehr, sondern „eine männliche Person, die etwas gemietet hat“ – die „Mieterin“ ist entsprechend „eine weibliche Person, die etwas gemietet hat“. Das hat den Vorteil, dass man den vollständigen Eintrag in jedem Fall sofort findet: „Wir haben sehr viel Kritik in den letzten Jahren dafür eingesteckt, dass wir bei den weiblichen Formen nur einen Verweis-Artikel dastehen haben“, wie Kathrin Kunkel-Razum, die Leiterin der Duden-Redaktion, gegenüber dem Deutschlandfunk Kultur erklärte. In Zuschriften an die Redaktion sei immer öfter eine Gleichstellung der Geschlechter im Online-Duden gefordert worden. Eine vollständige Abschaffung des generischen Maskulinums sei damit aber nicht beabsichtigt: „Selbstverständlich gibt es solche Formen, dass man sagt, ich gehe zum Bäcker, ich gehe zum Fleischer, oder ich gehe zum Arzt.“ Hier sei dann aber die Einrichtung und keine konkrete Person gemeint, also die Bäckerei, Fleischerei oder Arztpraxis. „Wenn wir über konkrete Personen sprechen, dann wird das generische Maskulinum zunehmend infrage gestellt.“ An der gedruckten Version des Duden ändert sich übrigens nichts, denn dann müsste er deutlich dicker werden.
Und was ist daran nun so bedrohlich, dass man die deutsche Sprache gegenüber der Duden-Redaktion in Schutz nehmen müsste? Der VDS fährt schweres Geschütz auf: „Damit widerspricht der Duden nicht nur den Regeln der deutschen Grammatik, sondern auch dem Bundesgerichtshof, der im März 2018 letztinstanzlich festgehalten hat, dass mit der Bezeichnung „der Kunde“ Menschen jeglichen Geschlechts angesprochen seien.“
Die Vorstellung, die Duden-Redaktion könnte in einem Konflikt mit dem Bundesgerichtshof stehen, ist freilich absurd. Der Gesetzgeber hat die deutsche Sprache nicht reglementiert: Jeder, ob Deutscher oder Ausländer, kann sie so verwenden, wie er oder sie es für richtig hält – ist allerdings auch selbst dafür verantwortlich, sich verständlich zu äußern. Entsprechend kann man die Bedeutung von Wörtern auch nicht vor Gerichten einklagen. Allein die Rechtschreibung, die an Schulen gelehrt und von Behörden verwendet wird, ist in Erlassen der Bundesländer festgelegt, zuletzt durch die Rechtschreibreform von 1996. Außerhalb der Schulen sind diese Regeln rechtlich unverbindlich.
Der Bundesgerichtshof, auf dessen Urteil sich der VDS beruft, hat auch nichts dergleichen behauptet – ganz im Gegenteil. Die Klägerin in diesem Fall hatte sich mit der Formulierung „der Kunde“ in einem Schreiben ihrer Sparkasse nicht angesprochen gefühlt und wollte die Sparkasse zwingen, auch die weibliche Form zu verwenden. Das Gericht hat nicht entschieden, dass man ein generisches Maskulinum verwenden müsse, sondern dass niemand daran gehindert werden kann, es zu tun.
Aber wenn das Recht schon nicht reicht, die Duden-Redaktion in die Schranken zu weisen, dann vielleicht die Tradition: Der Duden betreibe „eine problematische Zwangs-Sexualisierung, die in der deutschen Sprache so nicht vorgesehen ist.“ Aber was sollte es denn sein, das in der deutschen Sprache vorgesehen wäre? Und wer sollte es sein, der da etwas vorgesehen hätte? Natürliche Sprachen haben ja keinen Erfinder, der eine feste Vorstellung davon gehabt hätte, wie ein Wort oder eine grammatische Konstruktion zu gebrauchen wäre. Und gäbe es einen Erfinder des Deutschen, dann spräche er Althochdeutsch und würde über unser Deutsch nur den Kopf schütteln – er könnte es nicht mehr verstehen.
Wie etwas vorgesehen ist, ergibt sich aus dem Sprachgebrauch, und dieser verändert sich stetig. Daher ist die Tradition keine Instanz, die hier mitzureden hätte. Es ist ja nicht einmal eine uralte Tradition, die das generische Maskulinum für sich beanspruchen könnte. Tatsächlich ist es nur dadurch entstanden, dass sich die Welt verändert hat, die Sprache jedoch (zunächst) nicht. Wenn die meisten Berufsbezeichnungen in ihrer Grundform ein Maskulinum sind, dann geht das darauf zurück, dass beispielsweise Schmiede, Ärzte und Bürgermeister für viele Jahrhunderte eben stets Männer waren. Weibliche Bezeichnungen wie „Krankenschwester“, „Hebamme“ oder „Hausfrau“ gab es nur für Tätigkeiten, für die man lange Zeit allein Frauen zuständig hielt. (Es gab zwar auch schon früher einen „Hausmann“ – mein Nachname „Hußmann“ ist dessen niederdeutsche Version –, aber damit war keine männliche Hausfrau gemeint, sondern ein Bauer, der Besitzer des Hofes war, den er bewirtschaftete, also kein bloßer Pächter.)
In den letzten hundert Jahren haben sich Frauen den Zugang zu vielen einst Männern vorbehaltenen Berufen erkämpft, aber bei der maskulinen Grundform der Berufsbezeichnung ist es geblieben. Es kam lediglich eine durch „-in“ gebildete weibliche Form hinzu, und wenn man sich nicht auf ein Geschlecht festlegen wollte, griff man weiter auf die maskuline Grundform zurück. Das generische Maskulinum entstand, weil sich die Gesellschaft weiterentwickelte, die Sprache aber nicht, oder nicht in gleichem Maße.
So etwas ist nicht ungewöhnlich. Die Bürgerschaft, das Parlament meiner Stadt (Hamburg), wird beispielsweise von deren Bürgern gewählt – das ist seit vielen Jahrhunderten so. Für die längste Zeit verstand man unter „Bürger“ aber nicht jeden, der in Hamburg seinen festen Wohnsitz hatte, sondern nur Männer, die über Grundbesitz verfügten, der evangelisch-protestantischen Konfession angehörten und nicht adelig waren – insgesamt vielleicht 5 Prozent aller Hamburger. Die Bedeutung von „Bürger“ ist heute eine fundamental andere, aber das Wort blieb dasselbe.
Das generische Maskulinum ist, wie gesagt, nicht unumstritten – ganz im Gegenteil. Konstruktionen wie das Gendersternchen (auch in der gesprochenen Sprache als sogenannter Glottisschlag wie in „Beamter“), die das generische Maskulinum ersetzen sollen, werden bereits von einigen deutschen Behörden und in immer mehr Medien verwendet. Ob sich solche Bestrebungen durchsetzen werden, weiß man natürlich nicht. Hier setzt nun die einzige Überlegung des VDS an, die tatsächlich ernst zu nehmen ist: „der Duden [sei] auf dem Weg, seine Rolle als Standard-Referenzwerk für das Deutsche aufzugeben. Indem er Sprache nicht mehr nur widerspiegelt, sondern sie aktiv verändert, widerspricht er seinen eigenen Grundsätzen.“ Der Duden sollte die Regeln der deutschen Sprache bloß beschreiben und nicht eigenmächtig festlegen. Aber die Sache ist ein bisschen komplizierter.
Die Sprachwissenschaft sollte rein deskriptiv arbeiten: Linguisten erforschen, wie Sprecher des Deutschen tatsächlich reden und schreiben, ohne dabei zu werten. Für den Duden galt das nie so uneingeschränkt. Das Deutsche zerfällt ja in viele Dialekte und Soziolekte, und dem Duden als Standardwerk wäre kaum damit gedient, wenn darin jede irgendwo und von irgendjemandem gebrauchte Form aufgenommen würde. Österreichische und Schweizer Begriffe sowie manche Wörter der Umgangssprache werden zwar berücksichtigt, aber grundsätzlich orientiert sich die Duden-Redaktion an der deutschen Hochsprache. Gegen ein rein deskriptives Vorgehen hat sich der Duden auch bei der Rechtschreibreform entschieden: Statt abzuwarten, ob und inwieweit die Deutschen diese Reform für sich akzeptieren würden, wurden auf einen Schlag alle durch die Reform geänderten Schreibweisen aufgenommen. Dort, wo die Erlasse Wahlmöglichkeiten ließen, optierte die Duden-Redaktion durchaus eigenmächtig bisweilen für die althergebrachte Schreibweise.
Es ist keineswegs ungewöhnlich, dass sich die Duden-Redaktion in gesellschaftlichen Debatten, die die deutsche Sprache betreffen, auf eine Seite stellt, statt jahrelang auf ein eindeutiges Resultat zu warten. Das kann man durchaus kritisieren, und es wird auch immer wieder mal kritisiert, aber hier muss man keine Gefahr für die deutsche Sprache befürchten. Wer weiß, vielleicht steht die Duden-Redaktion ja am Ende auf der Gewinnerseite, aber wie sich unsere Sprache entwickelt, bestimmen wir selbst, nicht der Staat und auch nicht der Duden. Die neun selbsternannten „Bestsellerautoren“, die die Petition des VDS unterzeichnet haben, könnten die deutsche Sprache viel eher durch ihre Bestseller als mit ihrer Unterschrift in die gewünschte Richtung lenken. (Ich finde es ja etwas peinlich, seinen Beruf als „Bestsellerautor“ anzugeben – wer es wirklich ist, muss das nicht betonen.)
Das gilt entsprechend auch für uns Nicht-Bestsellerautoren. Wie gesagt: Wer der deutschen Sprache etwas Gutes tun will, sollte mit gutem Beispiel vorangehen, was immer man darunter versteht. Das reicht schon.





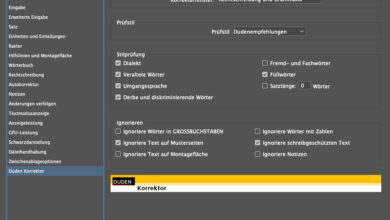
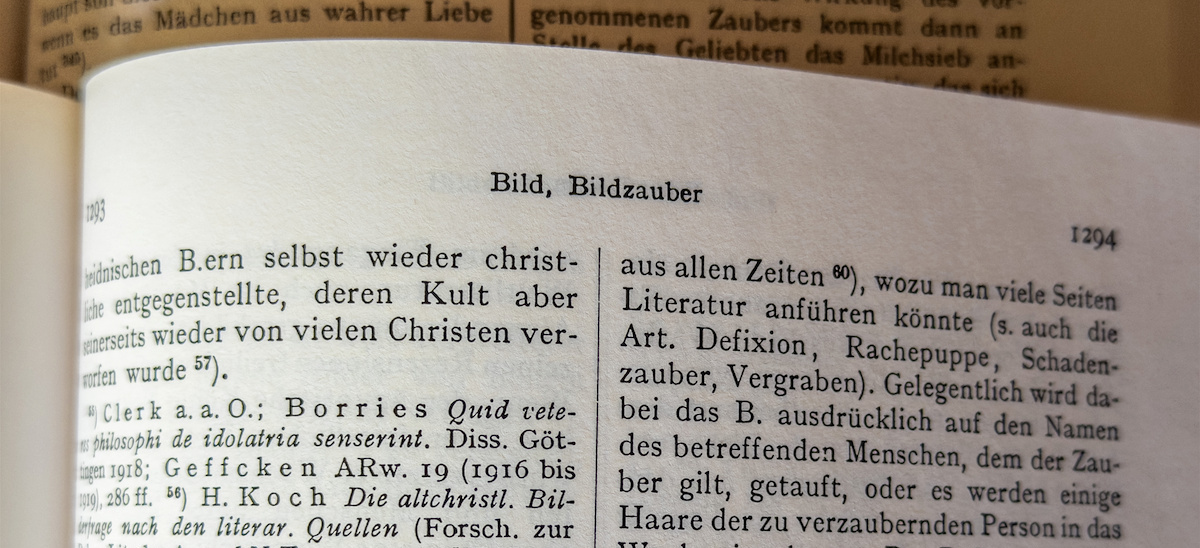
Das heute mehr E-Mails als Briefe versandt werden, dass auf (mobiles) Telefon anstatt auf reitende Boten zurückgegriffen wird, hat auch weithin mit der Faulheit der Menschen zu tun. Insofern ist schwer vorstellbar, dass sich längere Schreib- und Sprechweisen durchsetzen werden.
Zudem ist der Kampf für Gleichstellung der Frau im allgemeinen darauf ausgerichtet ist, keine Unterschiede zwischen Frau und Mann zu machen/haben. Eine darauf ausgerichtete Argumentation nun ausgerechnet mit unterschiedlichen, »gerechteren« Begriffen zu führen, erscheint da ein wenig schwierig.
Frauen gönnerhaft zuzugestehen, dass sie sich bei der maskulinen Form mitgemeint fühlen dürfen, wird von vielen Frauen nicht als Gleichstellung verstanden. Ist halt so.
Wer war denn so großzügig, und hat derartig Ungebührliches den Frauen gewährt?!
Selbst wenn man die »Schuldfrage« außer Acht lässt, bedarf das Problem einer Lösung. Die bisherigen Vorschläge scheitern in der Praxis an den oben genannten Gründen. Doch ohne pragmatischen Empfehlungen verharrt die Diskussion bei Nörgelei und Gezeter …
Hervorragende Darstellung eines Problems, für das es keine allseits befriedigende Lösung zu geben scheint.
Es ist doch ziemlich einfach, das Problem auch im Blick auf die kommenden Transformationen zu lösen:
Es ist doch ziemlich einfach, das Problem auch im Blick auf die kommenden Transformationen zu lösen:
Der Kunde*in*d*wh*c*sch*l*tg
oder
Der Kunde(m/w/d/wh/c/sch/l/tg) wobei die Reihenfolge per Zufallsgenerator gefunden werden sollte, um nun mal
keine*d*m*wh*c *sch*l*tg zu diskriminieren.
w=weiblich/d=divers/m=männlich(wh=white/c=coloured/sch=schwul/l=lesbisch/tg=transgender
Diese Sache mit dem Genderwahn geht mir sehr auf die Nerven und veranlasste mich vor zwei Jahren, als die alte Dame, Marlies Krämer heißt sie übrigens, vor Gericht zog, um dort zu erstreiten, in Briefen von ihrer Bank als „Kundin“ angeredet zu werden, zu einem Blogartikel. Weil ich das Anliegen der Dame abstrus fand (und immer noch finde).
Ich bin eine Frau und gute/klare/eindeutige/schöne Sprache ist mir sehr wichtig, nicht nur weil ich meine Brötchen als u. a. Lektorin verdiene, sondern weil gute/klare/eindeutige/schöne Sprache einfach Spaß macht – beim Lesen, Schreiben und Hören gleichermaßen. Auf Gendersprache lege ich keinen Wert, im Gegenteil. Sie stört (mich).
Schaue ich mir aber in Internetforen an, wie dort in Kommentaren und Texten mit der Sprache geschludert wird, packt mich das kalte Grausen. Der Unterschied zwischen „das“ und „dass“ zum Beispiel ist den wenigsten bekannt. Rechtschreibung und Grammatik sind Bildungsangelegenheiten, auf die während meiner Jugend großer Wert gelegt wurde. Heutzutage wird drauf los geschrieben/getippt, dass die Schwarte kracht – Fehler spielen dabei keine Rolle. Und ich rede nicht etwa von Tippfehlern, wie sie beim schnellen Tippen leicht entstehen können, sondern ich rede von dem allgemein verbreiteten und offensichtlich zunehmenden Mangel an Rechtschreib- und Grammatikkenntnissen.
Und dieser Mangel wird durch intensive Lektüre des DUDEN auch nicht unbedingt besser, denn in dem gelben Buch wimmelt es nur so von unlogischen Regeln – über die ich mich auf meinem Blog stets aufs Neue aufrege, weil ich ständig über unsinnige und unlogische Regeln stolpere (zum Beispiel: „zurzeit“ aber „vor Kurzem“).
Und jetzt auch noch diese Gendergeschichte. Die braucht kein Mensch – ich zumindest nicht, und ich fühle mich auch durch das generische Maskulinum nicht diskriminiert. Für mich ist Sprache ein Vehikel zu einer schnellen und reibungslosen Kommunikation, einerseits. Andererseits aber ist Sprache ein Kulturgut, das viele (mangels Interesse?) nicht beherrschen, was ich sehr bedauerlich finde, denn ich lese gern gut geschriebene Texte/Bücher und bei besonders gut geschriebenen Texten empfinde ich aufrichtige Freude. Aber dazu brauche ich keine Gendersternchen – weder geschrieben noch gesprochen. Wobei ich sie gesprochen ganz fürchterlich finde …
Ach ja, was ich auch fürchterlich finde: Petitionen von Bestsellerautoren (auf die Genderbezeichnung verzichte ich) zur Rettung der deutschen Sprache. In meinen Augen ist das lediglich der PR der Verfasser. Übrigens: Auch die Verfasser von Petitionstexten sollten auf korrekte Rechtschreibung achten – vor allem dann, wenn sie von (Bestseller)Autoren verfasst sind
Alles in allem: Der Duden sollte sich lieber um logische und nachvollziehbare Regeln bemühen als um gendersprachliche Begriffe.
Zitat Hußmann: „Wer der deutschen Sprache etwas Gutes tun will, sollte mit gutem Beispiel vorangehen, was immer man darunter versteht. Das reicht schon.“ Diese Meinung teile ich …
Auf den Punkt gebracht, Frau Blaes!
Viele Grüße,
auch von meiner Frau, und danke für den Tipp, das empfohlene Buch zu bestellen!
Sehr herzlichen Dank für Ihre klaren und präzisen Worte. –
Was momentan aktiv an Sprach-Schluderei betrieben wird (oft mit der Pseudo-Entschuldigung: „ach, ich habe keine Zeit zum Korrigieren, die wissen schon, was ich meine“), ist oft kaum noch zu ertragen.
Mit Gender-Sprache wird kein einziges Problem gelöst; es entstehen lediglich Diskussionen, die in meinen Augen ohne Nutzen und – anders als behauptet – weitestgehend folgenlos sind, lediglich oftmals Frust und neue Probleme erzeugen (Stichwort Glottisschlag). Entgegen mancher Argumente kann Sprache hier die ökonomischen und insgesamt gesellschaftlichen Verzerrungen nicht mal eben so beseitigen. Dazu bedarf es entsprechender Regulatorien, um diese leider noch so oft existierenden unsäglichen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten abzubauen.
Es ist richtig, dass sich Sprache entwickelt, und zwar im gesamten gesellschaftlichen Kontext. Sprache darf aber nicht von einigen Vorkämpfern mit Druck in eine gewünschte Richtung gepresst werden. Ist zumindest meine Meinung.
Hallo Kreberhard, genau das habe ich erlebt, als ich in einem Autoren(!)Forum bei FB die unglaubliche Menge an Fehlern in Beiträgen und Kommentaren bemängelt habe.
Ich wurde als „Grammar-Nazi“ bezeichnet.
Dann wurde erklärt, das Smartphone sei schuld.
Dann meinten viele, Fehler seien doch gar nicht so schlimm, es sei doch klar, was gemeint sei.
Wieder andere meinten, der Autor sei lediglich für den Textinhalt zuständig, um die Fehler würde sich der Lektor kümmern.
Irgendwann habe ich den Kampf gegen Windmühlen aufgegeben und bin aus der Gruppe ausgetreten. Nicht nur wegen der Trolle …
Um diesen Kommentar zu würdigen habe ich mich sogar registriert und angemeldet, denn dieser Kommentar ist diese kleine Mühe mehr als wert!
(Oh mein Gott – jedes mal denke ich „DER Kommentar“ und muss innerlich kopfschüttelnd über Genderwahnverbeiter lachen.)
Aber zurück zu meinem Anliegen: DANKE!
Danke für diesen Kommentar, er ist sowohl formal als auch inhaltlich eine Freude.
Es ist durchaus in Ordnung, sich als Frau nicht einhundertprozentig angesprochen zu fühlen durch die Bezeichnung Kunde, statt Kundin – deswegen vor Gericht zu ziehen ist aber bereits mehr als lächerlich, albern und sollte wegen Verschwendung wertvoller Ressourcen (u.a. Zeit der Gerichte und ihrer Angestellten) geächtet und verboten werden.
Was könnten Menschen wie Frau Marlies Krämer nicht alles wirklich sinnvolles tun mit dieser so elend verschwendeten Kraft und Zeit – gemeinnützige Arbeit leisten, oder einfach den ganzen Tag in Internetforen Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigieren, selbst das wäre tausend mal besser…
Wie auch immer – ich wollte einfach nur sagen: Danke!
Ich danke hubertusO, kreberhard und stevensonntag für die Kommentare! Dass sich stevensonntag sich dafür sogar hier anmeldet, ist eine Wertschätzung der speziellen Art. Danke dafür!
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch mal zum Ausdruck bringen, dass mir bewusst ist, wie viel Wert in dieser Redaktion auf gute Sprache gelegt wird. Egal, wer hier schreibt, ob der Doc, Christoph Kühne, Michael J. Hußmann oder sonst wer … es ist deutlich zu sehen, dass hier Texte nicht mal eben rausgehauen werden. Neben dem Anspruch des Verfassers an sich selbst, erlebe ich das auch Wertschätzung dem Leser gegenüber. Daran könnte sich so manch andere Redaktion ein Beispiel nehmen …
Stimmt, Frau Blaes!
Ähnlich gut aufgehoben fühle ich mich lediglich noch im redaktionellen Teil und im Leserforum der NZZ, während ich mich bei der ZEIT schon seit längerem und leider mittlerweile auch bei der FAZ „allein unter Idioten“ wähne…
Ich goutierte fürher auch die NZZ, aber gut ist sie nur noch sprachlich. Recherchiert wird kaum mehr und Text und Bildunterschriften oder Bildtexte widersprechen sich immer öfter. Schade.
Auch werden Bilder fast nur noch übernommen oder da stehen dann unsögliche Beispilfotos.
PS: Danke für den Buchtipp ganz oben! Habe das Buch eben bestellt, es wird gebraucht bei A und Medimops angeboten. Bin schon gespannt darauf.
Das Argument, Sprache sollte „richtig“ oder „gerecht“ sein, weil ja die Sprache / Gedanken so unerbittlich das Handeln formen, daß nur gute Sprache zu gutem Leben führt? Ist halt Wunschdenken. Geschlechtsneutraler Sprachen, z.B.: chinesisch… persisch… türkisch… keine feministischen Paradise? Dann hat sich das Argument wohl erledigt.
Keine anderen Sorgen, Herr Hußmann?
– Gratulation!
Ich finde die gendergetriebene Verballhornung der deutschen Sprache furchtbar, besonders in der gesprochenen Form.
Ist schon witzig, diese Diskussion, wo die deutsche Sprache doch neben m und w auch eine sächliche Möglichkeit hat. Bei Leuten, die sich durch eine Geschlechts-Angabe benachteiligt fühlen, verwende ich dann eben letztere. Nun ist es eben DAS Fotograf, das Kunde und das Mensch. Ein hier bekannter Fotograf hat seinen Vornamen mitten in seiner voraussichtlichen Lebenszeit von „Lucien“ auf „Lucia“ gewechselt, aber das ist wohl eine andere Geschichte…
Ich nutze auch nicht das „scharfe sz“, sondern „ss“, weil diese unverständliche deutsche Version auf meiner Tastatur nicht existiert. Habe zwar ein Dokument, das angibt, ich hätte einen Bürger-Eid geleistet und sei deshalb Bürger der Hansestadt Hamburg. Rechtlich sieht das das Bundesrepublik wohl anders.
Persönlich nutze ich nun eben das geschlechtsneutrale sächliche Form.
der Postillion hat geschrieben:
Tischler ist neutral
Tischlerin ->feminin
Tischlerer->maskulin
schließlich wollen wir Männer auch eine eigenen Endung haben.
LG DD
Also wenn schon, denn schon!
– Wieso regt sich eigentlich niemand auf über die vielen Stellenangebote, wo man immer wieder lesen muss:
„Produktionsmitarbeiter gesucht (m/w/d)“
Wobei m/w/d doch zweifellos steht für männlich/weiß/deutsch!
ODER???
You made my day, sitze gerade vor dem Bildschirm und kichere vor mich hin …