Die Peitsche mit den Krallen

Vor ein paar Tagen kam Doc Baumann von einer Israel-Reise zurück. Jerusalem war der letzte Ort, der ihm bei den Recherchen für seinen Roman noch gefehlt hatte. Anders, als man das von einem Atheisten erwarten sollte, hatte er sich für diese Fahrt einer katholischen Pilgergruppe angeschlossen. Doch auf dem Besuchsprogramm standen nicht nur Tempelberg, Grabeskirche und der Garten Gethsemane, sondern auch das Holocaust-Museum Yad Vashem.
Der wie ein Keil in die Landschaft geschnittene Museumsbau von Yad Vashem (Denkmal und Name) ist Teil einer großen Anlage, die der Erinnerung an den Holocaust, die Ermordung und Vertreibung der europäischen Juden während der Nazi-Herrschaft dient. Hier gibt es die Allee der Gerechten unter den Völkern, in der jener Menschen gedacht wird, die Juden vor ihren Verfolgern versteckt haben (auch ein Schild mit dem Namen Oskar Schindlers findet sich hier), oder das Denkmal zur Erinnerung für die Deportierten (Foto oben), die dicht gedrängt in Viehwagons gepfercht wurden, ohne Essen und Trinken, tagelang bei Hitze und Kälte eingesperrt.
Um alle Ausstellungsstücke, Fotos, Filme und Erläuterungstafeln dieses Museums anzuschauen, brauchte man einen halben Tag – mehr, als unser Zeitplan zuließ. Von der ganzen Fülle des dokumentierten Grauens kann und will ich hier nicht berichten. Ich erinnere mich vor allem an ein kleines, eher unscheinbares Objekt, das für mich stellvertretend für all das Entsetzliche steht, das einem in diesem Gebäude auf jedem Quadratmeter begegnet. Ein handliches Objekt, in Augenhöhe in einer Glasvitrine ausgestellt.
Am Tag unseres Besuchs war das Museum gedrängt voll. Jeder Rekrut der israelischen Armee wird zu Beginn seiner Dienstzeit durch diese Räume geführt, um damit die Vergangenheit seines Volkes nie zu vergessen. An diesem Tag waren es Hunderte, die an den Führungen teilnahmen.
Den größten Teil der Zeit in diesen Räumen schwieg ich. Zum einen, weil die Last der Bilder und Texte Äußerungen kaum zuließ. Zum anderen aber, weil ich mich schämte, angesichts der dokumentierten Untaten unserer Väter- und Großvätergeneration hier deutsche Worte auszusprechen. Es war keine Angst vor aggressiven Reaktionen – es war schlichte Scham.
Das Objekt in der Vitrine wird etwa einen halben Meter lang gewesen sein (Fotos sind dort nicht erlaubt). Ein glatter Holzstab, am vorderen Ende daran befestigt drei kräftige Lederriemen. Jeder von ihnen endet in einer schweren Eisenkugel, etwas größer als der Durchmesser eines Zwei-Euro-Stücks. Und an jede dieser Kugeln ist eine Metallkralle geschweißt, wahrscheinlich in Handarbeit. Das Objekt war eine Peitsche. Wo es herkam, wer es benutzt hat – vielleicht stand es auf einem Schild daneben, ich kann mich nicht erinnern. Das Grauen, das diese Peitsche in mir erweckte, löschte alles andere aus. Ich konnte mich nicht gegen die blutigen Bilder wehren, die in meinem Geist aufstiegen.
Bei seiner Posener Rede vom 4. Oktober 1943 hatte Heinrich Himmler gesagt: „Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht …“
Diese Sätze sind oft zitiert worden. Ob er das mit dem „anständig geblieben“ wohl selbst geglaubt hat – oder ob es nur Hohn war? Ich musste in Yad Vashem an diese Worte denken,, und es war mir egal, wie er es gemeint haben könnte. Denn es war so oder so falsch. Vielleicht ging es vielen „anständigen“ deutschen Schlächtern tatsächlich um „Pflichterfüllung“ (vor deren unreflektierter Anwendung man vor diesem Hintergrund nur warnen kann). Diese kleine Peitsche aber war der Beweis, dass „Pflicht“ nicht alles war. Es hat auch Spaß gemacht.
Ein solches Werkzeug der Schmerzen und des bluttriefenden Todes bastelt man nicht „liebevoll“ zusammen, nur um Pflichten zu erfüllen. Man braucht es, um das Foltern und Töten für seinen Anwender lustvoll und befriedigend zu gestalten.
Ich habe vor 25 Jahren ein dickes Buch über die Phänomenologie des Horrors geschrieben; das Grauen in Literatur und Film ist mir wohlvertraut. Doch es gibt einen Film, den ich mir wahrscheinlich kein zweites Mal anschauen werde – und falls doch, weiß ich genau, an welcher Stelle ich meinen Blick abwenden werde: Es ist Mel Gibsons „Die Passion Christi“, jene Szene, in der Jesus von einem römischen Soldaten ausgepeitscht wird. Einer der Haken der Peitsche bleibt in seinem Fleisch hängen und der Soldat reißt ihn mit einem Ruck heraus. Hat der Folterknecht dabei gegrinst? In meiner Erinnerung hat er es, und dieses Grinsen tauchte wieder vor mir auf, als ich die angeschweißten Haken an der Peitsche von Yad Vashem vor mir sah.
Es gibt viele Folgerungen, die man aus dem Holocaust ziehen kann, als Mensch, als Deutscher. Eine ist für mich: So etwas darf nie wieder passieren – und verständlicherweise würde jeder Jude ergänzen: So etwas darf uns nie wieder passieren. Die andere: Die Würde des Menschen ist (soll sein) unantastbar. Man darf sie anderen nicht nehmen (nicht nur deshalb, weil man damit die eigene verliert).
Während ich schweigsam in unserem Reisebus saß und diese Gedanken durch meinen Kopf gingen, fuhren wir wenige Kilometer von Yad Vashem entfernt an einer hohen Betonmauer entlang, die das Land brutal zerschneidet, auf dem Weg zu einer palästinensischen Familie, die wir besuchen wollten.
Über den Umgang mit der Würde des Menschen heute werde ich in meinem nächsten Blog-Beitrag in einer Woche berichten.






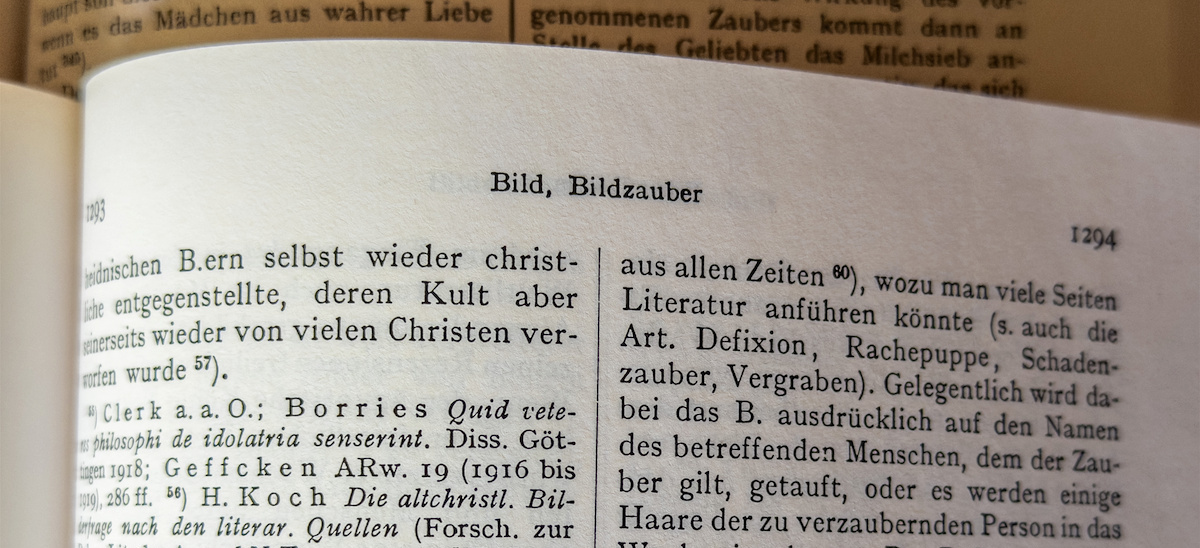
Es ist wie immer. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Gemeint ist das Bild mit dem Wagon.