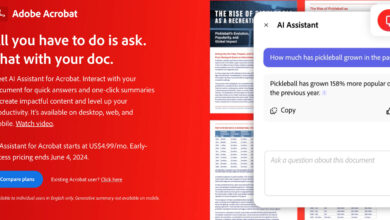Vom guten Bild
Wie macht man ein gutes Bild? Die Antworten auf diese Frage sind vielfältig. Christoph Künne begab sich auf die Suche nach Orientierung.

Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, einen Vortrag zu halten. Thema war "Der Weg zum guten Bild". Ich war sprachlos. Zumindest solange, bis mein Gegenüber präzisierte, es solle um den perfekten Workflow gehen. Mein kurzfristiger Sprachverlust warf Fragen in mir auf: Warum denke ich, wenn man von einem guten Bild spricht nicht an die Technik, sondern an die Aussage? Was ist überhaupt ein gutes Bild und wie kann ich tagtäglich die Qualität von Bildern beurteilen, ohne genau erklären zu können, was diese eigentlich ausmacht? Die Fragen ließen mich in der folgenden Zeit nicht los.
Ich suchte nach Antworten in meiner Umgebung. Bei vielen sehr erfolgreichen Bildgestaltern r´traf ich wenig hilfreiche Ansichten. Meist endeten die Gespräche mit: "… das sei halt Geschmacksache und über Geschmack ließe sich nunmal nicht streiten." Stammtischgeschwätz. Wer den französischen Soziologen Pierre Bourdieu gelesen hat, weiß es besser. Der hat vor über 30 Jahren in "Die feinen Unterschiede", herausgearbeitet, dass Geschmack nicht unhinterfragbar ist. Ihn bestimmen das kulturelle und das finanzielle Kapital sowie die Zugehörigkeitsdauer zur sozialen Schicht. Anders ausgedrückt: Ungebildete Neureiche haben einen ebenso klar vorhersagbaren Geschmack wie alteingesessene Ärzte, Arbeiter, Handwerker oder Intellektuelle. Neben Bildung, Geld und sozialem Ort ist ganz entscheidend, wie lange man schon zu seiner sozialen Gruppe gehört. Die erste Generation weicht in den Geschmacksvorstellungen stark von denen ab, die in ihrer Schicht schon länger zuhause sind. Da aber geschmacksbestimmende Hintergründe den wenigsten bewusst sind, können sie sich schwerlich darüber streiten. Von daher stimmt die Quintessenz. Mit Geschmacksurteilen kommt man nicht weiter, womit dann?
Ein Vorstoß in Richtung Kunst? Bilder, die als Kunst gelten, werden allgemein als gut angesehen. Anderenfalls würde für sie nicht soviel Geld bezahlt. Die einschlägige Literatur liefert eine Reihe interessanter Ansätze: Formal steht hier die "Schöpfungstiefe" im Vordergrund. Für eine Fotografie bedeutet das zum Beispiel, es reicht nicht aus, ein Bild einfach nur zu belichten. Beim Kunstwerk muss der Künstler auch für die Nachbearbeitung und die Herstellung eines Drucks Sorge tragen. Sonst entsteht kein Original. Da wären wir dann wieder beim Workflow-Thema. Das ist aber zumindest noch relativ eindeutig. Schwammig wird es auch hier wieder, wenn es um die Inhalte geht. Es gibt keine Festlegungen, doch muss das Abgebildete "Relevanz" besitzen und/oder über das hinausweisen, was abgebildet wird. Ein Bild von meiner Tante Erna kann also keine Kunst sein, wenn es Tante Erna nur als Tante Erna zeigt. Es wird aber zur Kunst, wenn ich mit dem Abbild von Tante Erna auf einen Typus Mensch verwiese, auf eine historisch relevante Situation (Tante Erna beim Durchbrechen der Berliner Mauer 1989) oder auf einen Kontext, der Tante Erna zum Sinnbild für etwas macht. Vielleicht erklärt das, warum es so viele hochgehandelte Bilder gibt, die berühmte Menschen zeigen, auch wenn deren fotografische Qualität vor dem kritischen Auge eher mäßig erscheint.
Ein weiteres Merkmal ist handwerkliche Qualität. Sie wird wird jedoch eher von der technophilen Kunst-kommt-von-Können-Fraktion geschätzt. Von jenen Fotografen also, die zwar Kunst für die Kunst produzieren (und nicht für eine kommerzielle Verwertung), aber leider im Sinne der Kunst nichts zu sagen haben, sich stattdessen der Dokumentation möglichst vieler Graustufen oder dem Herausarbeiten feinster Details verschreiben und am Ende über die Authentizität des Abgebildeten fabulieren. Sie fotografieren mit dem qualitativ besten Equipment unter zuhilfenahme der sachdienlichsten Brennweite und sehen anschließend zu, bis zum Druck möglichst wenig von der Qualität zu verlieren. Letztendlich auch nur ein Workflow-Thema.
Wem das Hineininterpretieren oder das Graustufensammeln nicht liegt, für den gibt es eine weitere Strategie: das Konzept. Konzeptionelle Arbeiten sind eine relativ junge Spielart der Kunst. Hier geht es vornehmlich darum, eine bedeutungsvolle Idee mit formal-technisch begrenzenden Faktoren auszuarbeiten und diese dann bildlich eindrucksvoll umzusetzen. Heraus kommen dann zum Beispiel eine Serie von Menschen, die Fastfood (Geißel der Neuzeit) verzehren. Abgelichtet über mehrere Jahre und auf mehreren Kontinenten.
Zum Glück müssen sich die Konzepte hinter den Bildern nicht unbedingt selbst erklären, denn dafür gibt es Ausstellungskataloge und wortgewandte Kuratoren. Hier geht es also mehr ums Durchhalten der Idee gegen alle sachlich technischen Widerstände. Wer das dann noch mit klassischen Gestaltungsprinzipien mischt, fast alle anerkannten Regeln der Aufnahmepraxis beherzigt und ein paar davon aufs Heftigste bricht, um visuell Neues zu schaffen, der ist schon ganz weit vorne auf dem Weg zum guten Bild.
Helfen uns diese Erkenntnisse nun weiter? Wohl kaum, denn am Ende geht es aber darum, dass die Bildern jemanden (und sei es nur man selbst) berühren. Möglichst nicht nur, weil man mit einer speziellen Technik gearbeitet hat, sondern wegen dem, was sie zeigen. Auf ihre Art, auch wenn der Rest der Welt sie fürchterlich findet. Solche Bilder sind manchmal der Ausgangspunkt für große Künstlerkarrieren, aber nur manchmal. Es sind aber immer gute Bilder. Munter bleiben!